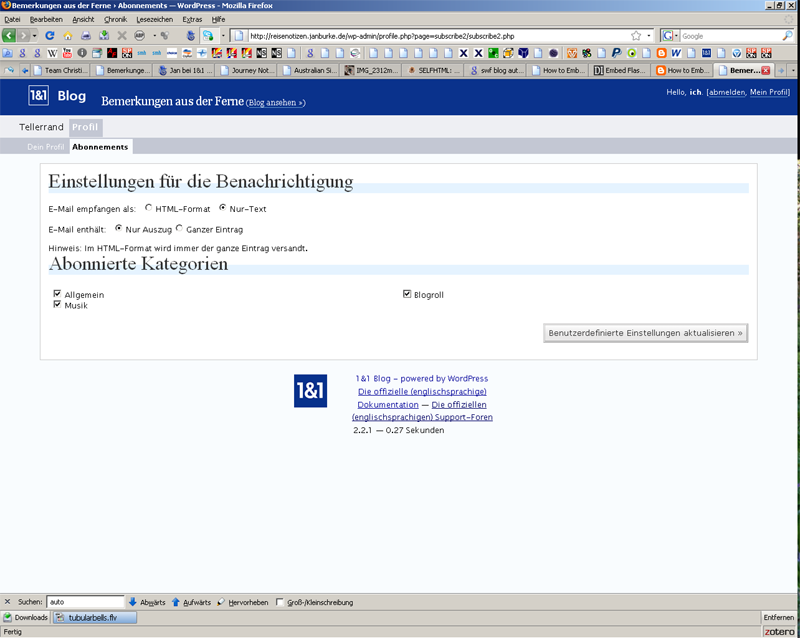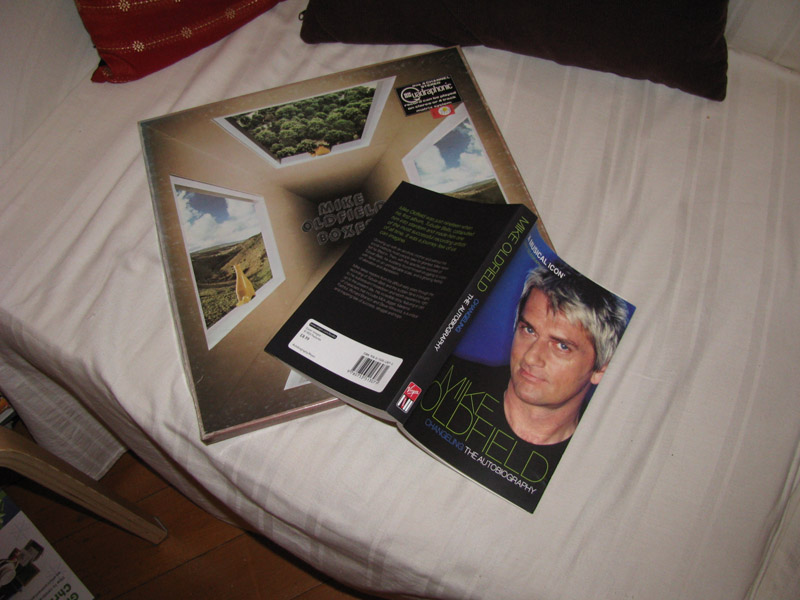Vor etwa einem Jahr bekam ich von meinen Eltern das Buch „Weltkrieg um Wohlstand“ geschickt, welches ich mir bei Spiegel Online bestellt hatte; es hatte schon in Deutschland eine Weile rumgelegen, und lag dann bei mir nochmal etwa ein Dreivierteljahr. Meistens lese ich in der Bahn, aber meine Lektüre, die in der Ortliebtasche reist, sieht danach immer etwas mitgenommen aus, und das wollte ich einem hübsch aufgemachten Piper-Buch eigentlich ersparen. Aber es ergab sich eben so, dass ich gerade nichts anderes für die Bahn zu lesen hatte, und so fing ich denn doch an – und das Buch hat die Strapazen eigentlich ganz gut überstanden.
Ich hatte schon „Deutschland: Abstieg eines Superstars“ vom selben Autor gelesen, und wollte jetzt das Neueste (wenn auch schon wieder nicht mehr ganz frisch) zum Wettlauf der alten und neuen Industriemächte erfahren – ich hatte während der Lektüre schon mal ein bisschen nach Rezensionen rumgeguckt, aber mich dann (auch weil viele Urteile ziemlich negativ ausfielen) entschlossen, mir erstmal meine eigene Meinung zu bilden.
Inzwischen habe ich das Buch schon seit ein paar Wochen ausgelesen und wollte doch noch eben meinen Senf dazugeben: man kann den Wert des Buches so sehen wie die FAZ (ich weise schon mal darauf hin, dass Gabor Steingart hauptsächlich für den Spiegel schreibt, und ich werde anlässlich dieses Buches über den Spiegel mehr zu sagen haben als über Herrn Steingart, der sich selbst zur Versicherung seiner Wichtigkeit ohnehin genug ist), die SZ (Original-Artikel nur noch als gebührenpflichtiges Dossier erhältlich), oder auch die ZEIT. So weit die Fachleute, denen die Vereinfachung oftmals zu weit geht, auch wenn sie einigen Beobachtungen zustimmen. Dann kommt man vom Perlentaucher zur linken Presse, wo etwas mehr Ärger zu beobachten ist: in der FR, und natürlich auch in der taz – wo aber die Kritik am neoliberalen Weltbild und der ungehemmten Globalisierung selbstverständlich gern gesehen wird.
Nun bin ich in allen diesen Dingen natürlich nicht genügend bewandert (und lese auch deshalb ab und zu mal ein Buch); insbesondere ist die gesamte Sekundärliteratur mir fremd, auf welche in „Weltkrieg um Wohlstand“ dankenswerterweise nicht als Fußnoten überall hingewiesen wird, sondern welche sich in einem immerhin zehnseitigen Literaturverzeichnis am Ende des Buches befindet. Das fand ich ziemlich gelungen. Und mir aus all diesen Quellen eine Übersicht zusammenzuschreiben und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, dafür habe ich Herrn Steingart ja auch bezahlt.
Worin ich aber bewandert bin, das ist die deutsche Sprache, und worüber ich mich beim Lesen dieses Buches am meisten geärgert habe, ist der nachlässige Umgang mit derselben. Denn ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass, wer nicht sorgfältig formuliert, auch nicht sorgfältig denkt. (Man nehme zum Einstieg das Wort „sorgfältig“ und lasse es sich bitte langsam im Sprachzentrum zergehen.)
Auf den Seiten 256-257 kommt beispielsweise das folgende Sündenregister zusammen:
„Der Prolet von einst besaß vieles, was die Armen von heute nicht mehr haben“, heißt es da – wer „Prolet“ schreibt, wenn er „Proletarier“ meint, verrät uns damit schon allerlei über sich selbst.
Weiter: „Sie[…] kriechen immer tiefer in ihre Wohnsilos hinein, wohin ihnen dutzende von Soziologen gefolgt sind“ – letzteres ist gut so, und es heißt „Dutzende“, auch wenn es tatsächlich wohl eher Hunderte (und nicht hunderte) sind.
Dann kommt ein mit „und“ beginnender Nebensatz, der durch ein Komma abgesetzt gehört, den ich aber wegen seiner Länge und damit aus Faulheit nicht aufschreibe.
Auf Seite 257 kommt der Klopfer: „Der neue Arme ist kein Widergänger des alten.“ Widergänger? Oder am Ende Wiedersacher? Ist das denn niemandem beim Korrekturlesen aufgefallen, dass es „Wiedergänger“ heisst? Werde ich beim Piper-Verlag gebraucht? Oder ist sowas inzwischen nicht mehr wichtig?
Im selben Absatz: „[es scheint], als habe das neuzeitliche Mitglied der Unterschicht sich selbst abgeschrieben.“ Da würde man es doch begrüßen, wenn der Autor sich um eine fachgerechte Verwendung des Konjunktivs bemühen wollte. Mit anderen Worten: „hätte“ heißt das hier.
Nicht falsch, aber auch nicht schön: „Das Auftauchen der neuen Unterschicht fällt nicht zufällig mit dem Abschied der Industriearbeitsplätze zusammen.“ Wäre nur noch etwas Mühe in die Druckversion des Manuskripts gegangen, wäre diese Stilblüte nicht übersehen worden.
Zum Schluss der Doppelseite: „Die Zerfallsprozesse im Innern der Gesellschaft bedrohen den Westen heute stärker als der internationale Terrorismus, auch wenn die Politiker sich auf die Bekämpfung von Letzterem konzentrieren.“ – warum darf es hier nicht „des letzteren“ heißen? Die Formulierung erkennt doch jeder wieder, die muss man doch nicht ohne Not zu vereinfachen suchen! Zumal, wie wir just erfahren haben, der Proletarier von heute ja ohnehin nicht mehr liest.
Dann werden auf Seite 292 drei Begriffspaare zur Diskussion versprochen; zwei davon werden noch auf Seite 292 geliefert, das dritte weder bis zum Ende des Abschnitts auf Seite 293, noch bis zum Ende des gesamten Buches. Da sei dem Leser die Frage erlaubt: ja will der mich verarschen? Werde ich hier nicht ernstgenommen, hat der Prof die Stunde nicht vorbereitet und verliert sich in Gefasel? Das fand ich ein starkes Stück, und es stört auch beim Lesen, weil man natürlich immer Ausschau hält nach der versprochenen Ordnung und Struktur. Aber zu der Zeit hat man ja schon fast 300 Seiten gelesen, seufzt kurz und denkt sich, das wird Herr Steingart wohl übersehen haben, und gesagt hat’s ihm auch keiner. Dann war’s wohl nicht so wichtig.
Im ganzen fand ich das Buch gar nicht mal so übel – insbesondere bei Umweltschutz und Kinder- und Sklavenarbeit stimme ich Herrn Steingart zu: natürlich können wir nicht dem freien Handel das Wort reden und dann einfach so Schutzzölle erheben, um unsere Arbeitsplätze zu schützen – aber die EU ist intern sehr pingelig bei Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und es ist überhaupt nicht einzusehen, warum das nur für die EU gelten sollte, aber nicht für Importe. Asien ist nicht nur fleißig, strebsam, sparsam und patriotisch, sondern es werden auch die natürliche Umwelt und die menschliche Arbeitskraft zum Teil auf das Brutalste ausgebeutet. Wer solcherart hergestellte Waren ins Land lässt, bestätigt die Ausbeutung als überlegene Form des Wirtschaftens und trägt zum Verfall der Errungenschaften des Westens bei. Wir können inzwischen blei- und cadmiumfreie Elektronikteile kaufen, auch aus Asien – vielleicht ist garantiert kinderarbeitsfreies Kinderspielzeug auch machbar? Wenn es in chinesischen Fabriken nicht mehr reihenweise Unfälle und Selbstmorde gibt und die Städte so sauber sind, dass man das Fenster seiner Wohnung im 20. Stock vom Boden aus sehen kann, und das alles immer noch billiger geht als in Europa – dann hat Asien zwar gewonnen, aber Europa auch.
Das ist mir zu diesem Buch eingefallen. Weiterhin noch einen schönen Gruß an Wolf Schneider, den ernstzunehmen Herrn Steingart gut täte. Und eigentlich wollte ich noch ein paar Zeilen zum Spiegel schreiben, der sich vom zeitweise sehr unbequemen Regierungsaufsichtsorgan leider zum Sprachrohr des Einheitsdenkens degradiert hat, und in Gesprächen oft sowas von billige rhetorische Fragen stellt, die im Grunde nur mit Vorurteilen die Systemkritiker diffamieren sollen – aber dafür fehlt mir jetzt die Zeit, und ich bin ja schon froh, wenn ich ab und zu mal was lesen darf, wo mir nicht von Anfang bis Ende das Selberdenken abgenommen werden soll. Auch sowas findet man ja noch im Spiegel ab und zu. Ich lese aber aus Notwendigkeit meist nur Spiegel Online, und weil das Publikum (ja, auch ich) sich nun mal hartnäckig weigert, für Qualitäts-Journalismus zu bezahlen, kriegt es eben auch keinen. Manchmal denke ich, gar keiner statt Billig-Journalismus wäre dann sogar besser.

 Nummer 1: Für den alten Laguna-Trecker, Februar 2006
Nummer 1: Für den alten Laguna-Trecker, Februar 2006 Fertig für die Radtour nach Wollongong mit Christine
Fertig für die Radtour nach Wollongong mit Christine